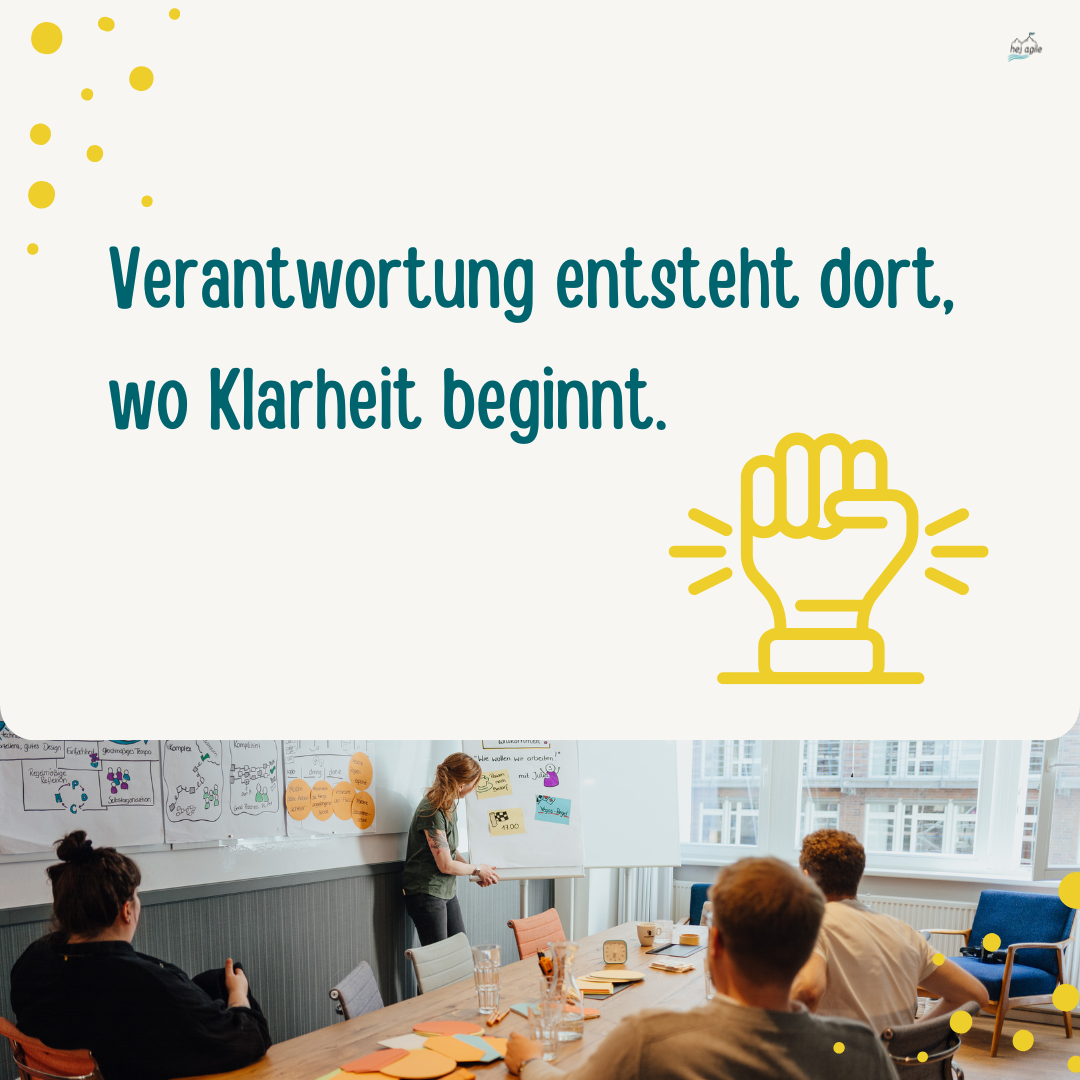Entscheidungen, die in der Luft hängen und wie ein Delegation Board Bewegung ins Team bringt
Entscheidungen sind die Währung von Zusammenarbeit – so ein schöner Satz, der häufiger mal zitiert wird und den wir vermutlich alle auch schon mal gehört haben. Aber was bedeutet das eigentlich in der Praxis? Für viele Teams ist genau diese Frage ein echter Knackpunkt, denn obwohl Entscheidungen tagtäglich getroffen werden – bewusst oder unbewusst – ist oft gar nicht klar, wer sie eigentlich trifft, wie sie getroffen werden und auf welcher Grundlage sie getroffen werden.
Ich erlebe in meiner Arbeit immer wieder Teams, in denen sich Entscheidungen ziehen, in denen Projekte feststecken, nicht weil die Aufgaben zu komplex wären, sondern weil niemand so genau weiß, ob man etwas überhaupt entscheiden darf oder ob nicht doch jemand anderes zuständig ist. In manchen Fällen entsteht daraus ein lähmendes Hin und Her, weil jede*r mitreden will oder glaubt, mitreden zu müssen, während gleichzeitig niemand so recht die Verantwortung übernehmen möchte. Und in anderen Situationen wiederum ist es so, dass Führungskräfte zwar mit gutem Willen in Richtung Selbstorganisation gehen wollen, die Verantwortung offiziell delegieren, aber dann doch, oft unbewusst, in den entscheidenden Momenten doch wieder eingreifen, korrigieren oder bremsen.
All das schafft Unsicherheit. Es hemmt den Fluss der Zusammenarbeit und sorgt dafür, dass Vertrauen leidet – auf allen Seiten. Genau hier kann das Delegation Board ein hilfreiches Instrument sein, allerdings nur, wenn es nicht als bunte Methode aus dem Methodenkoffer daherkommt, sondern als Einladung zu einem ehrlichen Gespräch darüber, wie Verantwortung im Team tatsächlich gelebt wird und nicht nur, wie sie auf dem Papier verteilt ist.
Ein Team zwischen Anspruch und Realität
Ich denke an ein Team, mit dem ich vor einiger Zeit gearbeitet habe. Die Ausgangssituation war geprägt von einer gewissen Unzufriedenheit auf mehreren Ebenen: Die Teammitglieder hatten das Gefühl, nicht wirklich mitgestalten zu können, während die Führungskräfte betonten, wie viel Freiheit sie dem Team doch bereits eingeräumt hätten. Gleichzeitig stockten Projekte, Entscheidungen wurden immer wieder vertagt oder endlos diskutiert und unter der Oberfläche war deutlich spürbar, dass etwas im Argen lag, auch wenn das zunächst eben nur nebulös benannt werden konnte.
In diesem Setting haben wir das Delegation Board als Struktur genutzt, um genau diese Unklarheiten sichtbar zu machen. Wir haben gemeinsam verschiedene Entscheidungsthemen gesammelt, von alltäglichen Fragen bis hin zu strategischen Entscheidungen und jede*r im Raum durfte einschätzen: Wie erleben wir das aktuell? Wie würden wir es uns eigentlich wünschen?
Was dabei entstand, war kein harmonisches Gesamtbild, sondern vielmehr ein vielschichtiger, manchmal auch widersprüchlicher Eindruck davon, wie unterschiedlich die Perspektiven im Team tatsächlich waren. Besonders deutlich wurde das an Stellen, an denen die Führungskraft der Überzeugung war, Verantwortung längst abgegeben zu haben, während das Team ganz klar spürte: Hier wird immer noch mitgesteuert – vielleicht nicht offiziell, aber durch Nachfragen, durch Kommentare, durch nonverbale Signale.
Was wirklich Wirkung entfaltet hat
Das Board selbst war dabei nicht das Entscheidende. Es war eher ein Türöffner, ein Rahmen, in dem unausgesprochene Wahrnehmungen ihren Platz finden konnten. Die eigentliche Wirkung entstand im Dialog, der im Anschluss möglich wurde: In den Gesprächen über konkrete Situationen, in denen Entscheidungen eben nicht so frei getroffen wurden, wie es vielleicht gedacht war. In der Auseinandersetzung mit der Frage, warum sich manche Teammitglieder zurückhalten, obwohl sie sich eigentlich mehr Verantwortung wünschen. Und in dem ehrlichen Eingeständnis, dass Loslassen (für viele Führungskräfte) auch mit einem Verlust an Kontrolle verbunden ist, der nicht immer leicht auszuhalten ist.
Was sich in diesen Gesprächen zeigte, war eine neue Art von Klarheit: Nicht im Sinne eines perfekten Delegationsmodells, sondern als geteiltes Verständnis darüber, wo man eigentlich steht. Und das war, so simpel es klingen mag, ein entscheidender Wendepunkt.
Klarheit ist nicht immer Konsens, aber sie schafft Orientierung
Am Ende dieses Prozesses stand kein fertiges, klare Delegationboard und auch kein ausformulierter Masterplan, sondern eine Vereinbarung auf Augenhöhe darüber, wie man in Zukunft mit Entscheidungsverantwortung umgehen will, ganz konkret und situationsbezogen. Es wurde benannt, welche Entscheidungen weiterhin in der Verantwortung der Führung liegen sollen, etwa weil bestimmte Risiken oder übergreifende Anforderungen damit verbunden sind. Gleichzeitig wurde entschieden, wo das Team mehr Autonomie bekommt und wie man im Alltag gemeinsam aufmerksam bleibt für die Momente, in denen sich etwas verändert: weil neue Themen auftauchen, Rollen sich verschieben oder neue Menschen dazukommen. Dabei wurde auch klar: Wir können gar nicht jede Entscheidung auf dem Reißbrett voraus denken. Viel mehr brauchen wir Klarheit darüber, wann wir sprechen müssen und eben auch, wie wir sprechen müssen, damit die unterschiedlichen Gedanken und Wahrnehmungen transparent werden.
Das Board war der Gesprächsanlass, die eigentliche Entwicklung fand im Gespräch statt. Und sie wird, das ist vielleicht das Wichtigste, auch nicht abgeschlossen sein. Denn Delegation ist kein Zustand, den man einmal definiert und dann abhakt: Sie ist ein Prozess, der immer wieder neu ausgehandelt werden will.
Was ich anderen Teams mitgeben würde
Wenn ich heute auf diese Erfahrung zurückblicke, würde ich sagen: Das Delegation Board ist kein Tool, das man einfach mal eben „anwendet“, um schnell Klarheit zu schaffen oder Konflikte zu lösen. Aber es ist ein unglaublich hilfreicher Gesprächsanlass – gerade dann, wenn im Team spürbar ist, dass etwas nicht rundläuft, aber noch niemand so richtig greifen kann, woran es liegt.
In dem Moment, in dem wir beginnen, über Verantwortung nicht abstrakt, sondern anhand konkreter Situationen zu sprechen und dabei unbedingt auch Raum lassen für Unsicherheiten, Widersprüche und persönliche Erfahrungen lassen, entsteht etwas, das weit über Methodenkompetenz hinausgeht: eine geteilte Verantwortungskultur. Und das, so meine Erfahrung, ist eine der wichtigsten Grundlagen für gelingende Zusammenarbeit.
Wenn ihr das ausprobieren wollt …
Das Delegation Board ist fester Bestandteil einiger meiner Workshop-Formate für Teams. Wir nutzen es, um gemeinsam hinzuschauen: Wo stehen wir gerade in unserer Entscheidungsdynamik? Was ist unausgesprochen? Und was braucht es, damit Verantwortung im Team nicht nur gewollt, sondern auch gelebt werden kann?
Mehr zum Workshop: Mehr Teamverantwortung mit dem Delegationboard