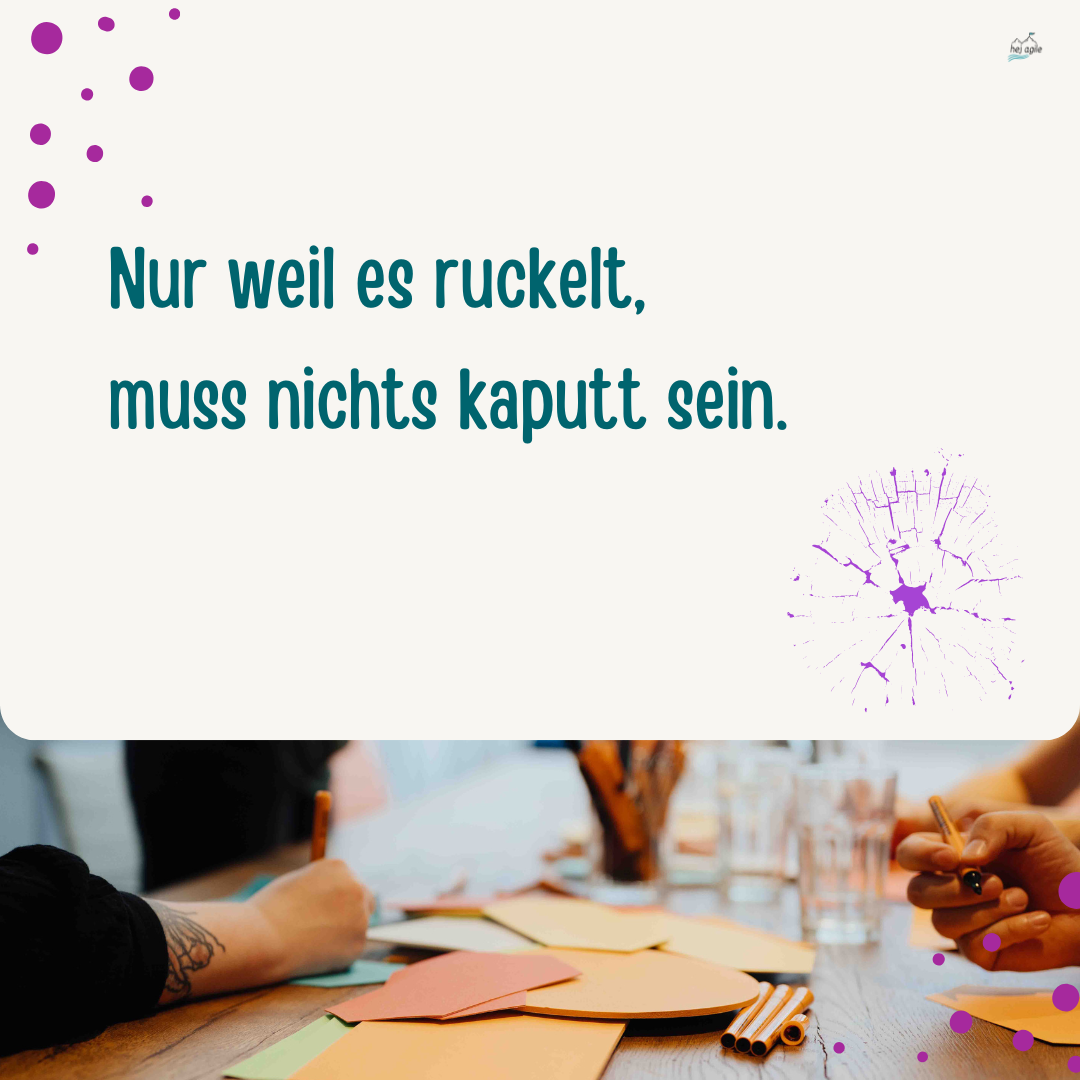Wenn Reflexion zum Druck wird
In vielen Teams ist Reflexion längst fester Bestandteil der Zusammenarbeit: Retrospektiven, Check-ins, Gesundheitschecks oder regelmäßige Feedbackschleifen gehören zum Standardrepertoire vieler (agiler) Arbeitsweisen. Sie sind normaler Teil des Miteinanders und gelernt.
Die Idee dahinter ist natürlich grundsätzlich sinnvoll: Wer sich regelmäßig die Zeit nimmt, bewusst auf die eigene Zusammenarbeit zu schauen, entdeckt Spannungen frühzeitig, kann Muster erkennen, bevor sie sich verfestigen und schafft die Voraussetzungen dafür, konstruktiv und kontinuierlich an Verbesserungen zu arbeiten. All das ist agil: Gemeinsam lernen, sich weiterentwickeln und auf unterschiedlichen Ebenen Feedback geben bzw. aufnehmen.
Regelmäßige Reflexion führt allerdings nicht immer zu mehr Klarheit, sie erzeugt mitunter auch Druck.
Wenn Aufmerksamkeit zu Überinterpretation wird
Dieser Druck entsteht oft nicht aus dem, was gesagt wird, sondern aus dem, was unausgesprochen mitschwingt: der Erwartung, dass jede Reflexion ein konkretes Ergebnis liefern muss. Idealerweise sind wir hinterher schlauer: Wir haben ein Thema identifiziert und können es bearbeiten. Wir haben ein Problem erkannt und es gelöst. Oder wir haben eine Maßnahme beschlossen, die wir umsetzen können. Allen geht es besser, weil dieses “Schlauer”-Sein eine Form der Wirksamkeit ist: Wir haben etwas getan. Wir haben uns damit beschäftigt. Wir waren wirksam. Veränderung wird kommen.
Stellen wir uns nun aber ein Team vor, das eine intensive Projektphase hinter sich hat. Mehrere Themen liefen parallel, Ressourcen waren knapp und die Abstimmung im Team war in dieser Zeit eher funktional als besonders verbindend. In der nächsten Retrospektive wirkt die Stimmung verhalten. Einzelne beschreiben ein Gefühl von Distanz oder weniger Energie im Miteinander. Andere formulieren, dass sie die Leichtigkeit vermissen oder das Gefühl haben, „gerade nicht wirklich miteinander verbunden zu sein“. Solche Rückmeldungen sind natürlich wichtig. Sie sind aufrichtig, differenziert und bieten grundsätzlich einen wertvollen Ausgangspunkt für weitere Gespräche. Doch was nun häufig passiert, ist ein reflexartiger Übergang in die Ursachenforschung: Die Gruppe beginnt zu überlegen, woran es liegen könnte, was verändert werden müsste, ob bestimmte Rollen klarer beschrieben, bestimmte Meetings effizienter gestaltet oder neue Formate für den Austausch eingeführt werden sollten.
Und genau hier kippt etwas: Denn was, wenn das Team gar kein strukturelles Problem hat? Was, wenn die beschriebene Unruhe schlicht Ausdruck einer anstrengenden Phase ist und gar kein Hinweis auf eine dysfunktionale Entwicklung? Was wenn die intensive Projektphase der Auslöser war, und das Gefühl vorher doch nicht gut war? Braucht es nun wirklich eine Veränderung? Ist das Wegfallen der intensiven Phase nicht Veränderung genug? Und was machen wir mit der Frage: “Aber sollten wir uns nicht überlegen, wie wir in der nächsten intensiven Phase besser miteinander umgehen und arbeiten?”
Was tun mit dem Impuls, etwas besser machen zu wollen?
Die Frage, wie man künftig besser mit intensiven Phasen umgehen möchte, ist nachvollziehbar und sie kann hilfreich sein. Aber nicht immer im direkten Anschluss. Mit etwas Abstand reflektiert es sich oft klarer. Was sich mitten in oder direkt nach einer belastenden Situation drängend anfühlt, verliert manchmal an Bedeutung, wenn der Druck wirklich nachlässt. Dann zeigt sich, was wirklich hängengeblieben ist und was Teil der Situation war.
Das Ergebnis der Reflexion darf auch sein: Ja, das war eine intensive Phase. Wir haben eher funktional als verbindend zusammengearbeitet und das hat für uns gut funktioniert. Nur: Danach braucht es etwas anderes. Etwas, das wieder Verbindung herstellt. Etwas, das bewusst macht, dass wir mehr sind als unsere Aufgaben. Ein gemeinsamer Moment, ein Gespräch oder ein kleines Team-Event für uns. Auch das kann Teil einer gesunden Teamkultur sein: nicht immer alles gleichzeitig zu leisten, sondern bewusst zwischen Phasen zu wechseln und sich im richtigen Moment wieder zu begegnen. Nicht jedes Problem ist so groß, wie es sich im ersten Moment anfühlt.
Der stille Zwang, etwas finden zu müssen
Teams, die regelmäßig reflektieren, entwickeln mit der Zeit häufig eine gewisse Erwartung an den Prozess selbst. Wenn schon Zeit in eine Retro oder Reflexion investiert wird, wenn alle an einem Tisch sitzen, wenn offen gefragt wird, wie die Zusammenarbeit läuft – dann entsteht oft der unterschwellige Druck, auch etwas benennen zu müssen, das nicht funktioniert.
Dieser Mechanismus ist nicht böse gemeint und selten bewusst gesteuert, aber er führt dazu, dass selbst kleinste Irritationen überinterpretiert werden. Gar nicht mal, weil sie objektiv bedeutsam sind, sondern weil sie gerade als einziger Ansatzpunkt für Veränderung im Raum stehen. Ein Meeting, das sich zieht, wird schnell zum Symptom für unklare Moderation. Ein einzelner Kommentar, der nicht aufgegriffen wird, wird zum Indikator für gestörte Kommunikation. Eine Stimmung, die weniger offen wirkt als sonst, wird zur Bestätigung, dass das Team „gerade nicht richtig in Verbindung“ ist.
In Wahrheit könnte es aber auch einfach ein normaler Tag gewesen sein.
Nicht alles, was zäh ist, ist ein Problem
In vielen Teams ist die Schwelle, etwas als „Thema“ zu markieren, sehr niedrig geworden – was grundsätzlich eine Stärke sein kann, weil es Sensibilität für Zwischenräume und Störungen schafft. Gleichzeitig führt diese Haltung oft dazu, dass jede Form von Reibung, Unklarheit oder fehlender Leichtigkeit sofort als Zeichen von Dysfunktion gewertet wird. Dabei ist Zusammenarbeit per se kein reibungsloser Zustand. Sie ist geprägt von Spannung, Unklarheit, Aushandlung, punktueller Überforderung und gelegentlicher Ermüdung, ohne dass daraus automatisch Handlungsbedarf entsteht.
Ein zähes Meeting ist nicht zwingend Ausdruck eines Moderationsproblems. Eine Phase mit wenig Energie muss nicht auf eine strukturelle Überlastung hinweisen und ein Gefühl von „Es läuft nicht rund“ kann schlicht bedeuten, dass gerade vieles parallel läuft und das Team mit seiner Aufmerksamkeit überall und nirgends ist.
All das ist nicht angenehm, aber normal.
Die Fähigkeit zur Einordnung
Teams, die dauerhaft unter dem Druck stehen, jedes Unbehagen aufzulösen, verlieren über kurz oder lang die Fähigkeit, Dinge einfach mal stehen zu lassen. Die Frage „Müssen wir da ran?“ wird zu selten gestellt und oft durch vorschnelle Aktivität ersetzt. Dabei wäre genau diese Unterscheidung zentral:
Ist das, was wir beobachten, ein wiederkehrendes Muster oder einfach nur eine Momentaufnahme? Ist es ein Hinweis auf ein Ungleichgewicht in der Zusammenarbeit oder eine normale Schwankung im Verlauf einer intensiven Arbeitsphase?
Wer diese Fragen stellen kann, gewinnt Handlungsspielraum und verhindert, dass aus Reflexion eine Art Dauerdiagnose wird, die mehr Unruhe schafft als klärt.
Reflexion braucht Gelassenheit
Gerade in gut aufgestellten Teams erlebe ich oft einen hohen Anspruch an Zusammenarbeit und an das Gefühl, das dabei entstehen soll. Offenheit, Klarheit, Fokus, Verlässlichkeit, Vertrauen, Effizienz, Sinn. Möglichst alles gleichzeitig, möglichst durchgängig, möglichst auf hohem Niveau.
Wenn dieses Ideal kurzfristig nicht erreicht wird, entsteht schnell der Eindruck, dass etwas nicht stimmt. Obwohl in Wirklichkeit nur gerade viel los ist, ein neues Thema angestoßen wurde, ein Wechsel stattgefunden hat oder das Team in einer Übergangsphase ist.
Der Anspruch an ständige Veränderung kann in solchen Momenten mehr schaden als helfen.
Manchmal reicht es, eine Phase als genau das zu sehen, was sie ist: anstrengend, uneindeutig, nicht optimal – aber eben auch nicht sofort besorgniserregend. Wer sich das erlaubt, handelt nicht weniger reflektiert. Sondern reifer.